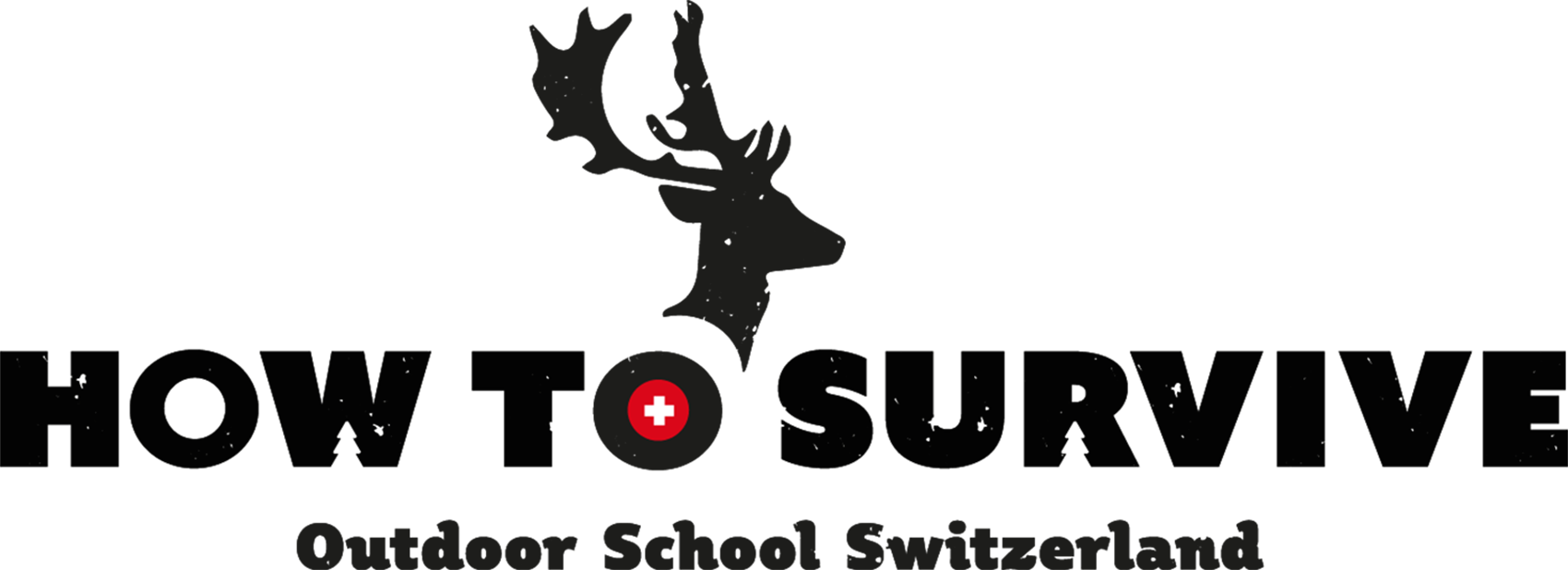Survival-Coach: «Was diese Kinder im Dschungel geleistet haben, ist unglaublich»
Wie ist es möglich, dass die vier Kinder 40 Tage in Kolumbiens Wildnis überlebt haben? Survival-Coach Markus Lusser nennt für dieses Wunder drei Gründe.


Herr Lusser, vier Kinder im Alter zwischen 11 Monaten und 13 Jahren haben im kolumbianischen Dschungel 40 Tage lang überlebt. Die internationale Presse spricht von einem Wunder. Sie auch?
Schon dass die vier Kinder den Flugzeugabsturz ohne schwere Verletzungen überlebt haben, während die erwachsenen Insassen ums Leben gekommen sind, grenzt tatsächlich an ein Wunder. Und dann 40 Tage lang im Dschungel durchzuhalten – das ist unglaublich, insbesondere wenn man bedenkt, dass ein Säugling dabei war. Aber dieses Wunder hat aus meiner Sicht drei Gründe.
Welche?
Ich war selber natürlich nicht dabei, und ich konnte auch nicht mit den Kindern sprechen, insofern stütze ich mich bei meinen Aussagen auf meine langjährige Tätigkeit als Survival-Trainer und auf die Berichte, die ich über den Fall gelesen habe. Ein Grund ist sicher, dass die indigenen Kinder von ihren Eltern und Grosseltern Kenntnisse hatten, die ihnen das Überleben ermöglichten – obwohl sie auch noch den Schock des Absturzes und den Tod ihrer Mutter verarbeiten mussten. Sie waren mit vielem im Dschungel vertraut, was für urbane Kinder oder Erwachsene absolut ungewohnt wäre.

Und die weiteren Gründe?
Dass es die Kinder schafften, sich genügend Nahrung und Flüssigkeit zu verschaffen. Dabei kam ihnen sicher zugute, dass es im Mai in dieser Gegend noch häufig und ausgiebig regnet. Und dann wussten sie offensichtlich, welche Pflanzen, Samen und Früchte essbar sind. Zusätzlich konnten sie etwas Nahrung aus dem Flugzeugwrack mitnehmen. Die Vorstellung, man finde in einer so dichten Vegetation leicht irgendetwas zu essen, ist übrigens falsch. Trotz ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse waren die vier Kinder denn auch ziemlich ausgemergelt, als man sie gefunden hat.
Welches war der dritte Grund für ihr Überleben?
Dass sie offensichtlich als Team funktioniert haben. Die Grösseren haben wohl die Kleinen umsorgt und den Lead übernommen. Es gibt viele Szenarien, bei denen ein solches Team auch auseinanderbrechen kann.
Zum Beispiel?
Dass es zu Konflikten kommt, dass jemand aus der Gruppe verzweifelt, aufgibt, den Lebenswillen verliert. Der Wille zu überleben ist in einer solchen Situation absolut zentral. Verheerend für die Psyche der älteren Kinder wäre es sicher auch gewesen, wenn das einjährige Mädchen es nicht geschafft hätte. Ich fände es unglaublich spannend, die Kinder zu fragen, was in ihren Köpfen während dieser 40 Tage vorgegangen ist. Wie sie es geschafft haben, mental durchzuhalten, welche Ziele sie sich setzten. Was sie geistig neben dem konkreten Überlebenskampf geleistet haben, ist wirklich unglaublich. Leider werden das Wissen und die Erfahrung, auf die sie zurückgreifen konnten, auch bei indigenen Völkern immer seltener.
Es ist sehr einfach, sich in der sicheren Zivilisation diese Frage zu stellen. Aber wäre es nicht besser gewesen, die Kinder hätten beim Flugzeugwrack ausgeharrt, statt durch den Dschungel zu irren?
Dazu müsste man wissen, was ihnen die Mutter empfohlen hat, bevor sie vier Tage nach dem Absturz ihren Verletzungen erlegen ist. Vielleicht hat sie ihnen gesagt, sie sollten Hilfe suchen. Laut Presseberichten könnte es auch sein, dass sie sich vor bewaffneten Gruppierungen verstecken wollten, die in diesem Teil des Landes noch immer ausgedehnte Territorien kontrollieren. Sich von der Absturzstelle zu entfernen, kann also für die Kinder durchaus sinnvoll gewesen sein. Grundsätzlich gilt aber: Es ist besser, am Ort des Unglücks auf Hilfe zu warten. Das Flugzeugwrack wurde ja auch zwei Wochen nach dem Absturz gefunden.

Wie gefährdet waren die Kinder durch Tiere?
In dieser Gegend gibt es alles, was uns Zentraleuropäern Angst macht: Raubkatzen, Schlangen, Spinnen. Auch giftige Pflanzen. Tiere waren für die vier Kinder sicher eine grosse Bedrohung, besonders nachts.
Waren Sie selber schon im kolumbianischen Teil des Amazonas?
Nein, aber schon mehrmals im peruanischen und brasilianischen.
Es sei im Dschungel auch tagsüber stockdunkel, weil das Sonnenlicht nicht durch das Blätterdach dringt. Wie haben Sie das erlebt?
Nicht so krass, wie Sie es schildern. Die Höhe der Bäume, die Dichte der Vegetation und des Blätterdaches sind enorm, aber so stockdunkel, dass wir uns nicht einmal tagsüber zurechtfinden konnten, war es bei unseren Expeditionen nicht. Das hängt aber sicher auch von örtlichen Gegebenheiten ab.
Was im Dschungel empfindet man als Mensch der urbanen westlichen Zivilisation sonst noch als besonders ungewohnt?
Den Lärm. Der ist gewaltig, Tag und Nacht, ständiges extrem lautes Gezirpe, ständig Rufe und sonstige Geräusche von Tieren. Das haut einen um.

Würden Sie eine Notlage überleben, wie sie die vier Kinder durchgemacht haben?
Das ist eine schwierige Frage. Ich hoffe, dass ich dank meines Wissens und meiner mehr als zehnjährigen Tätigkeit als Survival-Trainer durchgehalten hätte. Eigentlich gehe ich sogar davon aus. Aber sicher sein kann ich natürlich nicht. Denn ob sich zum Beispiel eine Infektion plötzlich verschlimmert, ob einen ein Jaguar angreift oder trotz aller Vorsicht eine giftige Schlange beisst oder eben nicht – das ist letztlich auch eine Frage des Glücks.
Bedauern Sie es als Survival-Trainer manchmal heimlich, dass Sie den Ernstfall letztlich immer nur trainieren, aber nie wirklich erleben? Dass Sie Ihre Fähigkeiten also noch nie in einer solchen Notlage beweisen konnten?
Nein, überhaupt nicht. Wir begeben uns bei unseren Expeditionen niemals bewusst in Gefahr. Gerade wenn man sich mit solchen Notlagen auseinandersetzt, wünscht man sich nicht, sie zu erleben. Und hofft trotzdem, im Notfall genügend vorbereitet zu sein.
In der modernen Zivilisation zu leben und intensiv Survival-Training zu betreiben – das bedeutet doch, sich auf etwas vorzubereiten, das kaum jemals eintreten wird. Ist das überhaupt sinnvoll?
Survival hat nicht nur mit Extremsituationen zu tun, wie sie die vier Kinder in Kolumbien erlebt haben. Eine Wanderin oder ein Snowboarder, die sich in nebliger Dämmerung verirren – das ist eine Situation, die auch in der sicheren Schweiz jederzeit eintreten kann und Survival-Skills erfordert. Survival-Training bedeutet vor allem, sich mit der eigenen Psyche und dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, deren Bedürfnisse zu kennen und fähig zu sein, sie zu stillen. Das bringt einem auch viel, ohne dass man in Gefahr ist.
Quelle: Tagesanzeiger – Sandro Benini